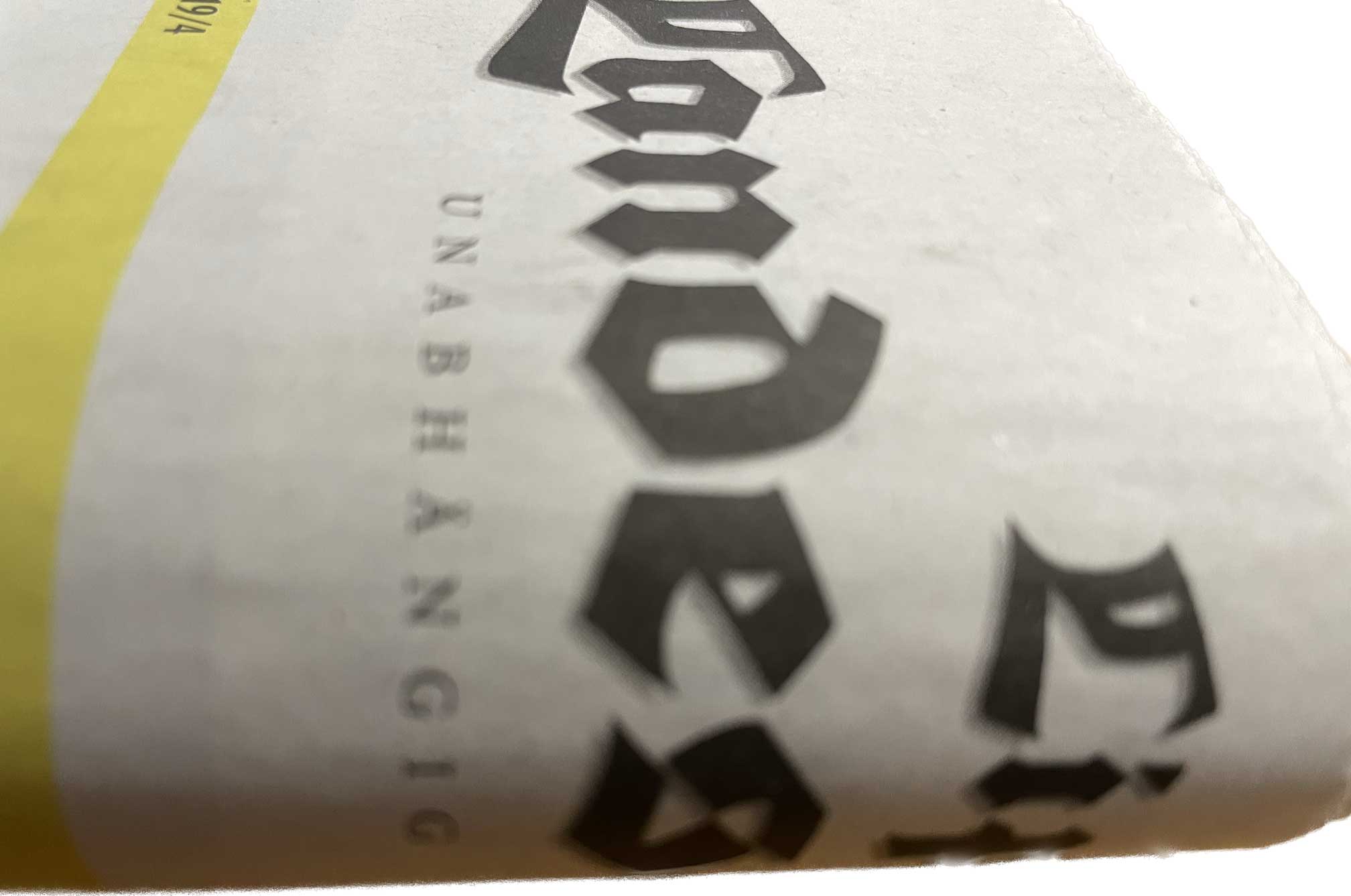Kann Kirche Demokratie?
Vielleicht sagen Sie jetzt so entschieden „nein“, wie es die Bundestagspräsidentin zu Regenbogenfahnen vor dem Reichstag getan hat.
Verübeln kann ich es Ihnen nicht. Zu oft kam in der Vergangenheit von kirchlicher Seite ein „basta!“ und damit war jede Diskussion vom Tisch.
Und wenn ich Ihnen sage, dass wir im November wieder im Erzbistum Paderborn wieder wählen werden? Und das sogar mit rechtlicher Grundlage. Und als Onlinewahl. Ja sehen Sie mal!
Aber Spaß beiseite: Wir werden zwei Gremien wählen.
Einerseits den Kirchenvorstand, das wirtschaftende Gremium, welches Finanzen, Immobilien, Personal und so weiter verwaltet.
Andererseits Räte, die über pastorale Themen – also das Leben in den Kirchengemeinden – berät. Also quasi so wie die vergangenen Jahrzehnte?
Darauf ein entschiedenes Nö.
Mit Udo Markus Bentz kam nicht nur ein neuer Erzbischof im vergangenen Jahr, sondern es begann einer der größten Veränderungsprozesse des Erzbistums.
An manchen Stellen vielleicht bitterlich herbeigesehnt. An anderen Stellen unbequem und drastisch. Aber sind wir mal ehrlich: Die Stellung von Kirche hat sich auch in Ostwestfalen gewandelt. Anforderungen sind andere geworden, die Welt um sie herum hat sich verändert.
Auch die Leben der Menschen, für die Kirche weiterhin wichtig ist, sieht nicht mehr so aus, wie noch vor fünfzig Jahren. Und nicht zuletzt ist Kirche auch – wie ein gewöhnliches Unternehmen – auch von seinen Ressourcen abhängig. Jetzt im Moment mangelt es vielleicht noch nicht am Geld. Aber können Sie sich vorstellen, dass in etwa zehn Jahren nur noch ein Drittel der heutigen Priester im Dienst sein wird? Von den Herausforderungen, die in Sachen Kundenbindung auf Kirche zukommen werden, einmal ganz zu schweigen.
Zuhause vom Sofa aus zu motzen ist simpel. In den sozialen Medien nörgelnde Kommentare von sich zu geben ganz großes Tennis. Miteinander zu überlegen, abzuwägen, zu diskutieren?
Ich habe in Kirchenvorständen leidenschaftlich geführte Debatten erlebt. Anstrengende Diskussionen, an deren Enden Ergebnisse standen. Und das Gefühl, wirklich gemeinsam etwas erreicht zu haben. Notfalls auch, in dem ein Pfarrer überstimmt wird. Das war vielleicht hilfreich, muss aber auch nicht immer sein.
Nur wenn Sie jetzt Lust genau darauf haben: Mit anderen zu überlegen, wie Kirche vor Ort in fünf, zehn oder zwanzig Jahren sein soll – wofür jetzt schon die Weichen gestellt werden müssen – dann kandidieren sie doch.
Denn auch wenn sich Kirche verändern wird: Sie kann immer nur so lebendig sein, wie die Menschen sind, die sich um sie kümmern.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Pfarrer oder in Ihrem Pfarrbüro.
Autor: Benedikt Getta